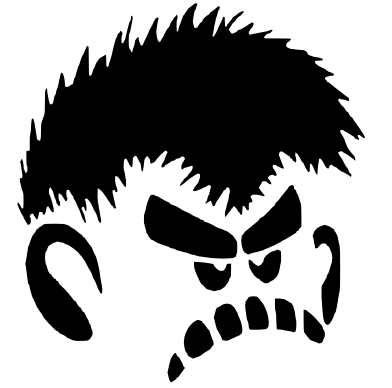Idee: Jonas (asri)
Autor:innen: Jonas (asri), Tristan Natsirt, Nym/Katha

- Die Wunderkugel von Dresden ist nicht, wie die meisten Wunderkugeln, aus Elfenbein, sondern aus Zypressenholz – angeblich vom Kreuz, an dem Andreas gemartert wurde. Die feine Drechselarbeit ist eine hohle, netzartig verzierte Kugel, in der eine kleinere hohle Kugel liegt, in der wiederum eine kleinere Kugel liegt… insgesamt fünf Kugeln sind es, aus einem einzigen Stück Holz gewirkt. Sie ist bereits in der Inventarliste der Kurfürstlichen Kunstkammer von 1587 geführt und stammt aus der Sammlung von August dem Sachsen, gilt aber seit einer Bestandrevision des Grünen Gewölbes von 1967 als verschollen. In einem Brief von William Lossow an seine Tochter Hanna erwähnt Lossow, die Wunderkugel untersucht und auf der Innenseite der dritten Kugel das Wort „vntergangk“ gelesen zu haben.
- Der Seelenstein ist ein handtellergroßer, durchscheinender Obsidian-Stein, kunstvoll mit feinen Gravuren verziert. Der Schliff erinnert an ein Gesicht, das je nach Blickwinkel zu lächeln oder zu weinen scheint. Der Legende nach fertigte ein talentierter, aber verbitterter Steinmetz den Seelenstein als Abschiedsgeschenk für seinen Meister, von dem er sich verraten fühlte. Der Stein lag lange im Besitz eines alten Ordens, welcher ihn als Objekt der Kontemplation nutzte. Einst schrieb ein Novize in seinen Aufzeichnungen, dass er im Stein „Klagende Augen“ wahrnahm, was der Orden als Hinweis auf die Sorgen der Sterblichen deutete. Seitdem gilt der Seelenstein als Ausdruck der menschlichen Seele – eine symbolische Verbindung zwischen dieser und der Anderswelt.
- Die verschollenen Webbriefe sind eine Sammlung von Webmustern, die die Archäologin und leidenschaftliche Hobby-Brettchenweberin Esmeralda Fliederfeld anhand von reich verzierten Bortenfragmenten aus eisenzeitlichen Hügelgräbern bei Leppendorf rekonstruiert hat. Fliederfelds Sammlung erlangte ungeahnte Bedeutung, nachdem ein Brand im Museum alle Exponate aus den Gräbern zerstörte. Um so schlimmer, dass auch die Webbriefe kurz darauf verloren gingen – ebenfalls bei einem Brand im Wohnhaus der Fliederfelds, bei der tragischerweise die gesamte Familie der Archäologin umkam. Gestützt von der Tatsache, dass auf einer der eisenzeitlichen Grabplatten ein altes Symbol eingeritzt war, das je nach Lesart entweder Medicus oder aber Magier bedeuten könnte, entwickelte sich rund um diese beiden Unglücke ein urbaner Mythos: So soll ein uralter Zauber in das Gurtband des Magiers eingewoben sein, dessen Muster Fliederfeld in ihrer Websammlung als „Die wiegenden Flammen“ benannt hatte. Unbemerkt von der archäologischen Fachwelt tauchen Jahre später in einem VHS-Kurs für Brettchenweben die verschollen geglaubten Webbriefe wieder auf. Kurz darauf kommt es im Materiallager des Kursraums zu einem Brand, der gerade noch rechtzeitig vom Hausmeister gelöscht werden kann.
- Das Krakauer Malachitfläschchen wurde vermutlich Mitte des 18. Jahrhunderts für Ira Elżbieta Tarnowski, eine Geliebte des ruthenischen Woiwoden August Aleksander Czartoryski (oder seines Bruders Michał Fryderyk, oder beider) angefertigt. Es befindet sich heute im Nationalmuseum in Krakau (im Erasmus-Ciołek-Bischofspalast). Ein Malachitpropf schließt das Fläschchen dicht ab, so dass die Flüssigkeit darin bislang nicht ausgetrocknet ist, wobei sowohl unklar ist, um was für eine Flüssigkeit sich handelt, als auch wann sie hineingefüllt wurde. Tarnowski war eventuell intersexuell. Fest steht, dass ihr 1783 Hexerei vorgeworfen wurde. Ihre Spur verliert sich zu der Zeit. Zu einem Prozess ist es offenbar nie gekommen.
- Die Gargouilles de Colmar – drei steinerne Wasserspeier – gelangten durch die Enteignungen im Zuge der französischen Revolution an das Musée Unterlinden in Colmar. Ihre Provenienz ist unklar, aber mutmaßlich stammen sie von gotischen Kirchen aus dem Elsaß. Sie zeigen die üblichen phantastischen Wesen mit dämonischen Zügen: Bedrohliche Fratzen und Krallen, tierartige Leiber, ledrige Flügel. Wer sich die Zeit nimmt, die Wasserspeier länger zu betrachten, erkennt nicht nur ihren individuellen Ausdruck, sondern auch die Aura von Müdigkeit und Trotz, die sie ausstrahlen.
- Zu den vielen Kunstschätzen, die unter fragwürdigen, imperialistisch geprägten Umständen den afrikanischen Kontinent verlassen mussten, gehört ein kleines Nilpferd aus Elfenbein. Trotz der geringen Länge von 5,5cm fängt die Schnitzarbeit gekonnt die respekteinflößende, massige Wucht des Tiers ein. Sir Malcolm Treborrim Wooley vermachte es zusammen mit weiteren Stücken dem British Museum, nachdem unter ungeklärten Umständen die Räume seines Landsitzes, in denen die Sammlung untergebracht war, zerstört wurden „als sei eine Dampflok hineingefahren“.

Lizenz (Text): CC BY 4.0
Bildquellen:
Bouwfragment, waterspuwer, inventarisatienummer BK-NM-8652-L. – CC BY-SA 3.0
Nécessaire de toilette pour le parfum, malachite. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. – CC BY 4.0